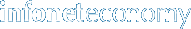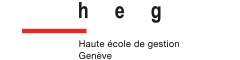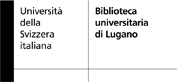Unternehmen mögen Ökologie: Lieber grün kleiden als Greenpeace auf dem Dach (Rezension)
Accéder
Auteur(s)
Accéder
Texte intégral indisponibleDescrizione
Das Konzept der sozialen und ökologischen Verantwortungsübernahme von Unternehmen - auf Neudeutsch: "Corporate Social Responsibility (CSR)" - hat sich in den vergangenen Jahren fest etabliert im Kanon der Managementkonzepte. Unternehmen legen sich CSR-Abteilungen zu, verfassen Nachhaltigkeitsberichte und unterwerfen sich sozialen und ökologischen Standards. Warum aber tun sie das, verursacht es zunächst doch vor allem Kosten? Hält etwa allseits Gutmenschentum und Altruismus Einzug in Firmenetagen? Diesen Fragen geht die Hamburger Soziologin Janina Curbach in ihrem Buch nach.
Ein erster Erklärungsweg lautet: Trotz der Kosten rentierten sich CSR-Aktivitäten schlussendlich, beispielsweise durch eine Minderung von Reputationsrisiken. Allerdings konnte ein Zusammenhang mit finanziellem Erfolg nie empirisch bestätigt werden. Studien des Zürcher Kommunikationswissenschaftlers Mark Eisenegger zeigen vielmehr, dass Unternehmen in die "Moralfalle" tappen können, je stärker sie sich durch CSR-Aktivitäten exponieren. Getreu dem Prinzip: Je höher man fliegt, desto tiefer der Fall.
Ein zweiter Ansatz argumentiert institutionentheoretisch. Unternehmen reagieren mit ihren CSR-Aktivitäten vor allem auf gesellschaftliche Erwartungen. Sie wollen ihre Legitimität sicherstellen. Demnach sind Unternehmen passive Opfer ihrer Umwelt. Bedrängt werden sie von Nichtregierungsorganisationen. Diese inszenieren Medienkampagnen und erzeugen so Legitimationsdruck, der vor allem multinationale Konzerne in CSR-Aktivitäten hineindrängt.
Die Autorin führt einen neuen dritten Ansatz in die Debatte ein: CSR lässt sich als soziale Bewegung beschreiben. Hierzu teilt sie die diffuse Gesamtheit der Nichtregierungsorganisationen in zwei Teilgruppen: Einerseits unternehmensnahe wie Verbände, andererseits kritische wie die Umweltorganisation Greenpeace. Überraschenderweise sind es die Unternehmen selbst, die im Verbund mit moderaten Nichtregierungsorganisationen die CSR-Bewegung vorantreiben. Die verbleibende Gruppe der Kritiker beklagt stattdessen unternehmerische Verantwortungslosigkeit. Greenpeace & Co. prangern weiterhin Verletzungen sozialer und ökologischer Prinzipien an. Sie verlieren aber an Gehör.
Damit können CSR-Aktivitäten als Kampf um Deutungshoheiten verstanden werden. Mit ihnen etablieren Unternehmen ein eigenes Deutungsmuster. Kurzum: CSR verursacht zwar Kosten, sichert jedoch eine gewisse Lufthoheit in der Debatte. Dank nüchterner Analyse gelingt es der Autorin, den jüngsten Debatten zu diesem CSR einen überzeugenden dritten Erklärungsweg hinzuzufügen
Institution partenaire
Langue
Data
Le portail de l'information économique suisse
© 2016 Infonet Economy