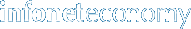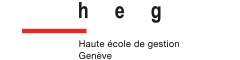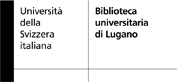MRI of the orbit during eye movement
Accéder
Auteur(s)
Accéder
Texte intégral indisponibleDescrizione
Ein grundlegenderes Verständnis der peripheren okulomotorischen Pathophysiologie könnte zur Verbesserung der Strabismuschirurgie beitragen. Konventionelle strabologische Untersuchungsmethoden sind hilfreich, um Augenmotilitätsstörungen zu erkennen. Dennoch ist in komplexen Fällen eine präzise Diagnose mit den pathophysiologischen Erkenntnissen, die durch diese Untersuchungen und mit einem quasi agonist-antagonist extraokular Muskel-Modell gegeben sind, nicht möglich; besonders nach einer Chirurgie der extraokularen Muskeln, welcher sich das okulomotorische System anpasst. Das Problem liegt in der Verbindung von Daten der dynamischen Augenbewegung mit statischen Orbitagewebe-Konformationen. Das unvollständige Verständnis der Umwandlung der neuronalen Steuerungssignale in mechanische Augenbewegungen provozierte eine jahrzehntelange Kontroverse über die aktive oder passive Rolle des orbitalen Bindegewebes, die noch geklärt werden muss. Momentan stehen keine geeigneten dynamischen Daten zur Beurteilung des orbitalen Gewebeverhaltens zur Verfügung, selbst wenn dynamische (Un-)Gleichgewichte existieren, wie z.B. bei Verletzungen des Listingschen Gesetzes während schnellen Augenbewegungen, in bestimmten Fällen. Dies hat, zusammen mit der Komplexität der orbitalen Biomechanik, die Entwicklung eines angemessenen neuro-biomechanischen Orbitamodells verzögert. Gleichzeitige hohe räumliche und zeitliche Auflösung der Kinetik des Orbitalgewebes während der Augenbewegung würde die Umwandlung des neuronalen Signals in eine mechanische Wirkung besser beschreiben. Daraus ergeben sich die Ziele dieser Arbeit: Erstens soll ein klinisch benutzbarer visueller Reiz entwickelt werden, welcher periodisch wiederholende Augenbewegungen im Inneren des Scanners erzeugt. Damit sollen segmentierte Magnetresonanz-Bilder (MR-Bilder) ohne Bewegungsartefakte in einer genügend kurzen Zeit synchron aufgenommen werden. Zweitens soll die Bildaufnahme mit Hilfe von TFEPI durch Wahl eines reduziertes Sichtfeldes (FOV) und k-t BLAST beschleunigt werden. Drittens soll die Bewegung (CDENSE, CSPAMM) und Geschwindigkeit (Q-Flow) direkt in Bilder der Augenhöhlen kodiert werden, um zusätzliche Bewegungsdaten in der begrenzten Aufnahmezeit zu liefern. Viertens ist die dynamische Verformung der Orbitagewebe durch neue, bildrauschresistente, modellfreie Methoden zu quantifizieren. Weiter war die Messung der (vermuteten) inhomogenen Kontraktion entlang den Augenmuskeln und die Differenzierung der normalen gegenüber der pathologischen Deformation während den Augenbewegungen ein wichtiges Ziel. Diese neue Messgrößen der Augenhöhlenmechanik und deren Steuerung sollten das Verständnis der Strabismusätiologie verbessern. Die ersten hoch aufgelösten anatomischen, bewegungs- und geschwindigkeitskodierten Bilder der Deformationsdynamik der Augenhöhlen wurden mit der beschriebenen Methode erfolgreich aufgenommen. Dreidimensionale anatomische und bewegungskodierte MR-Bilder konnten mit hoher räumlicher und zeitlicher Auflösung in weniger als 10 Minuten durch eine Beschleunigung der Bildaufnahme gewonnen werden. Die Verformung des Orbitagewebes während der Augenbewegung konnte quantifiziert werden. Zum ersten Mal konnten die räumlich-zeitlichen Verformungsmuster des Glaskörpers visualisiert und viskoelastische Modellparameter quantifiziert werden. Verschiedene Arten von Deformationsmustern des Glaskörpers konnten beschrieben werden. Die Viskosität und Elastizität des Glaskörpers wurden durch ein viskoelastisches Modell bestimmt. Somit sind relevante Modellierungsparameter der Augenhöhlebiomechanik in vivo quantifiziert worden. Die Differenzierung des dynamischen Deformationsprofils entlang der Augenmuskeln von Duane-Syndrom Patienten gegenüber physiologischen Deformationsprofilen erlaubte die nicht funktionellen Segmente der pathologischen Muskeln zu bestimmen und lieferte neue Einblicke in die okulomotorische Steuerung. Das erweiterte Verständnis der Physiologie des Orbitagewebes und deren neuronalen Kontrollmechanismen könnte bisher unerkannte Ursachen des Schielens klären, welche traditionelle Konzepte verbessern oder alternative Behandlungen vorschlagen könnten. Die Ursachen von Krankheiten wie neuronal bedingte Lähmung, verzögerte neuromuskuläre Übertragung, mechanische Beschränkung und Entzündung der Augenmuskeln voneinander zu differenzieren kann jetzt geplant werden.
Institution partenaire
Langue
Data
Le portail de l'information économique suisse
© 2016 Infonet Economy