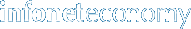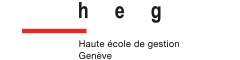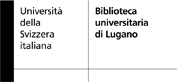Auswirkungen eines Hochrisikopools auf die Risikoselektion im Schweizer Krankenversicherungs-Wettbewerb: Eine empirische Klärung
Accéder
Auteur(s)
Accéder
Texte intégral indisponibleDescrizione
In der Volksabstimmung vom 11. März 2007 unterstützte eine grosse Mehrheit der Schweizer Stimmberechtigten einmal mehr den Wettbewerb in der sozialen Krankenversicherung. Die Diskussionen im Vorfeld des Urnengangs zeigten aber ebenso deutlich, dass die Risikoselektion auf wenig Verständnis
stösst. Besonders stark wird – inzwischen auch von einer Mehrheit der Krankenversicherer selbst - das Aushöhlen der Einheitsprämie durch billige Tochterkassen kritisiert.
Die wissenschaftliche Diskussion des letzten Jahrzehnts unterstreicht, dass der Anreiz zur Risikoselektion systembedingt ist. Solange die Einheitsprämie mit einer allzu groben Berechnung des Risikoausgleichs kombiniert wird, stellt die Risikoselektion die optimale Marktstrategie dar. Im Wettbewerb, wo jeder Versicherer gezwungen ist, seinen Kunden möglichst günstige Prämien zu offerieren, wächst daher der Druck, zum Mittel der Selektion zu greifen, auch wenn der Mehrheit der Versicherer bewusst ist, dass Risikoselektion in einer obligatorischen Sozialversicherung eine Verschwendung volkswirtschaftlicher Ressourcen darstellt. Zur Behebung des Problems haben die Schweizer Gesundheitsökonomen
grundsätzlich zwei wissenschaftlich unbestrittene Lösungsvorschläge eingebracht: Der Wechsel von der Einheitsprämie zu risikogerechten Prämien oder eine morbiditätsorientierte Berechnung des Risikoausgleichs.
Der erste Vorschlag fand in der Politik keinen Widerhall, während der zweite Vorschlag in den Revisionsvorschlag des Ständerats vom 8. März 2006 aufgenommen wurde. Nach Ansicht des Ständerats soll die Risikoausgleichsberechnung um das Kriterium „Spitalaufenthalt im Vorjahr“ ergänzt werden. In
jüngster Zeit brachte Bundesrat Couchepin als Alternative zur Ständeratsposition die Idee eines Hochrisikopools in die Diskussion ein. In diesem Pool sollten die teuersten Versicherten zusammengefasst und in Rahmen eines staatlichen Disease Management-Programms betreut werden.
Die vorliegende Arbeit untersucht, gestützt auf die Angaben von 180'000 Versicherten während eines Zeitraums von 8 Jahren, wie sich der Hochrisikopool auf den Anreiz zur Risikoselektion auswirkt. Der Befund ist eindeutig.
Da nur wenige Versicherte für einen Hochrisikopool in Frage kommen, reduziert er die Prämienvorteile der Risikoselektion kaum und Risikoselektion bleibt für den einzelnen Versicherer die erfolgreichste Strategie. Zudem werden durch staatliche Disease-Management Programme die Möglichkeiten privatwirtschaftlicher Innovationen sowie die Wahlfreiheit gewisser Patienten eingeschränkt, was dem aktuell geäusserten Willen der stimmenden Bevölkerung nicht entspricht. Durch den ständerätlichen Revisionsvorschlag
hingegen werden die Anreize zur Selektion signifikant reduziert, die Auswirkung der Selektion auf die Prämienvorteile abgedämpft und das (vom Gesetzgeber gewünschte) Kostensparen durch Managed Care zur gewinnbringenden Strategie im Markt gemacht.
Die vorliegenden Resultate werden von der vergleichbaren Literatur gut gestützt. Sowohl betreffend der Effektivität des Ständeratsvorschlags als auch der relativen Wirkungslosigkeit des Hochrisikopools, gibt es unter den zahlreichen empirischen Analysen keine, die einen widersprechenden Befund liefern würde.
Institution partenaire
Langue
Data
Le portail de l'information économique suisse
© 2016 Infonet Economy