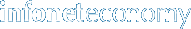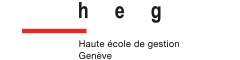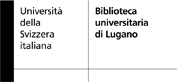Die politische Verantwortung globalisierter Unternehmen: Bemerkungen zum wirtschaftsliberalen Trennungsmodell
Accéder
Auteur(s)
Accéder
Texte intégral indisponibleBeschreibung
Die Rolle der Unternehmung in der Gesellschaft ist seit vielen Dekaden ein umstrittenes Thema. Dies lange bevor das Wort „Globalisierung“ seine Bekanntheit erfahren hat. Die Kontroverse wird zum einen vor dem Hintergrund konkurrierender Theorien der Unternehmung ausgetragen, zum anderen ist sie aber auch als Folge der Kritik am Verhalten einzelner Unternehmen zu verstehen, mit der die praktische Dimension dieser Rollenbestimmung immer wieder vor Augen geführt wird. Die Tagespresse ist voll mit derartigen
Berichten: Korruption, Kinderarbeit, Umweltverschmutzung, gesundheitsschädigende Arbeitsbedingungen, Unterdrückung gewerkschaftlicher Betätigung und andere Vorwürfe, mit denen Multinationale Unternehmen immer wieder konfrontiert werden. Dies betrifft etwa die Spielwaren-, die Textil- und Sportartikelindustrie. Hier lassen viele westliche Handels- und Markenartikelunternehmen ihre Produkte zu günstigen Arbeitskosten in Drittweltstaaten fertigen. Dies oftmals unter Nichtbeachtung der elementarsten Menschenrechte, die in vielen Entwicklungsländern vom Gesetz nicht geschützt sind oder von den Behörden nicht durchgesetzt werden. Aus diesem Grunde fordern Menschenrechtsgruppen die Multinationalen Unternehmen dazu auf, in den betreffenden Ländern freiwillig die Menschenrechte der UNO sowie die Arbeitnehmerrechte der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) einzuhalten und auch die Zulieferer darauf zu verpflichten. In eine ähnliche Richtung zielt der Global Compact der Vereinten Nationen, mit dem der Einfluss der Multinationalen Unternehmen zur weltweiten Durchsetzung der Menschenrechte sowie Arbeits- und Umweltstandards genutzt werden soll. Die Unternehmen sollen damit ganz klar öffentliche Aufgaben übernehmen, weil in vielen Entwicklungsländern die Regierungen diese Aufgabe nicht wahrnehmen können oder wollen und Supranationale Organisationen, wie etwa die UNO oder die ILO, keine Interventionsmöglichkeit zum Schutz dieser Rechte haben.
Diese Forderungen sind freilich umstritten. Manche Autoren und Politiker befürchten, dass die Forderung nach einer Harmonisierung von Arbeits- oder Umweltstandards nur allzu leicht als protektionistische Maßnahme missbraucht werden könnte. Im Übrigen sei es die Pflicht der Unternehmen, die weltweit kostengünstigsten Produktionsmöglichkeiten zu nutzen, weil nur so das vorhandene Kapital optimal eingesetzt werden kann. Zugleich können auf diese Weise die Entwicklungsländer ihre Kostenvorteile zur Geltung bringen und sich in die weltweiten Produktions- und Handelsprozesse einklinken. Die Unternehmen sollten daher grundsätzlich nicht auf solche Forderungen der UNO und der Menschenrechtsgruppen eingehen. Was ist von solchen Forderungen zu halten? Welche Verantwortung sollen Unternehmen übernehmen? - Dies ist Gegenstand der Erörterung im vorliegenden Beitrag.
Institution partenaire
Langue
Datum
Le portail de l'information économique suisse
© 2016 Infonet Economy