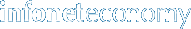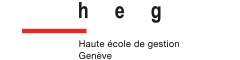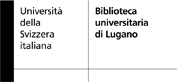Bilden und betreuen? Diskurse und ihre alltagspraktische Verankerung in Materialität, Ästhetik und Rhythmus
Auteur(s)
Accéder
Texte intégral indisponibleBeschreibung
Die pädagogische Qualität in Schweizer Kindertagesstätten wurde in den letzten Jahren verstärkt auf die Agenda gesetzt. Zugleich gelten Kindertagesstätten jedoch nach wie vor als Orte, an denen in erster Linie Betreuung stattfindet. Obwohl sowohl Bildung als auch Betreuung für die Qualität einer Einrichtung als gleichermassen relevant angesehen werden, werden beide noch allzu häufig in binärer Opposition und damit sich gegenseitig ausschliessend verstanden. Die historische Entwicklung zeigt, dass die pädagogische Arbeit in der frühen Kindheit zwischen den Polen „sozial“ und „pädagogisch“, „privat“ und „öffentlich“ verortet wurde (Rabe-Kleberg, 2003, S. 31). Während „Betreuung“ stark an einem Ideal der hausfraulichen und mütterlichen Weiblichkeit orientiert ist, wurde „Bildung“ stärker als Profession gelesen, die männlich konnotiert ist. Beide Diskurse sind geschlechterdifferenzierend aufgeladen.
Mit dem Forschungsprojekt „(Un)doing gender in Kitas“ haben wir mit ethnographischen Methoden untersucht, wie die zwei Diskurse „Bildung“ und „Betreuung“ in
der Alltagspraxis relevant gemacht werden. Die Analyse der videogestützten Beobachtungen an insgesamt 15 Tagen in 4 Kindertagesstätten zeigt auf, dass dies auf unterschiedliche Weisen geschieht. Während in zwei der von uns untersuchten Kitas beide Diskurse in binärer Opposition verstanden werden, herrscht in zwei weiteren Kitas eher ein gleichberechtigtes Miteinander beider Verständnisse vor.
Wir konnten zwei unterschiedliche „ideal worker“ identifizieren. Während dieser im ersten Fall stark an einer „hausfraulichen Weiblichkeit“ orientiert war, steht im zweiten Fall die Unterstützung frühkindlichen Lernens im Zentrum. Neben der Identitätsarbeit der Kinderbetreuenden rückten so unterschiedliche Idealvorstellungen von „guter Erziehungsarbeit“ in den analytischen Fokus. Diese konnten anhand ihrer Stabilisierung durch die Materialität und Ästhetik des Raums wie auch die Rhythmisierung des Arbeitsalltags ethnographisch zugänglich gemacht werden. In meinem Beitrag werde ich die für die Diskursethnographie zentrale Rolle eines solchen intermediären Konzepts wie dem des „ideal worker“ näher ausführen
Institution partenaire
Langue
Datum
Le portail de l'information économique suisse
© 2016 Infonet Economy