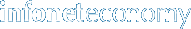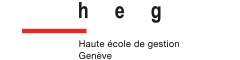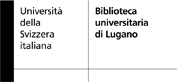Automatisierte Emotionen und die Möglichkeit ihrer Reflexion in künstlerischen Praktiken: eine ANT-Perspektive
Auteur(s)
Accéder
Texte intégral indisponibleBeschreibung
Ob wir Museen, Kirchen oder Bibliotheken betreten, stets wissen wir, wie wir uns zu verhalten haben: Wir senken unsere Stimme, verlangsamen unseren Schritt und nicken andächtig unseren Mitmenschen zu. Wir können die Heiligkeit dieser Räume förmlich spüren und werden dabei unweigerlich Teil ihrer Atmosphären. Wir werden in spezifische, semantische Relationen eingebunden, bzw. in Position oder Rollen innerhalb dieser Gefüge "übersetzt". Ohne unser bewusstes Dazutun partizipieren wir mehr oder weniger automatisch an den Ordnungen dieser Räume.
Die in der Wissenschaftssoziologie verwendeten Konzepte "Ordnungsweise" (Law) und "Inszenierung" (Mol) erlauben es das Zustandekommen solcher räumlicher Atmosphären in relationalen Praktiken zu verorten und zu verstehen, wie sowohl menschliche als auch nicht-menschliche Akteure an diesen partizipieren.
Ausgehend von einem agonistischen Demokratiebegriff (Mouffe) und einem objektorientierten Öffentlichkeitsverständnis (Latour) wird in diesem Beitrag die Frage gestellt, wie sich Partizipation an den Atmosphären öffentlicher Räume in Form reflexiver Praktiken gestalten lässt. Zu diesem Zweck werden zwei künstlerische Stadtraum-Interventionen als Beispiele öffentlicher Raumproduktion beschrieben und in Bezug auf ihre ästhetischen Wirkweisen untersucht.
Der sogenannte "Gedankengang" - eine Intervention eines St. Galler Künstlerteams im Rahmen einer Museumsplanung - sowie der unter dem Namen "Parkours" bekannt gewordene Strassensport dienen als Beispiele dafür, wie Körper und Gebäude in alternative Ordnungsweisen eingebunden, Orte neu inszeniert und Räume somit zu Verhandlungssache gemacht werden können.
Institution partenaire
Langue
Datum
Le portail de l'information économique suisse
© 2016 Infonet Economy